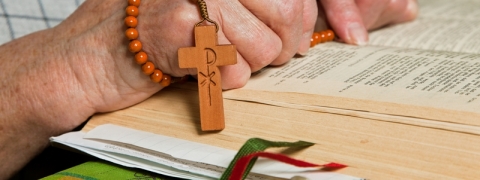Das Alte Testament stellt einen wichtigen Bestandteil der heiligen Schriften der großen Weltreligionen von Christentum und Judentum dar. Es besteht zum größten Teil aus dem als Tanach bezeichneten heiligen Schriften des Judentums, die von den Urchristen und in der Thora noch um weitere Texte ergänzt wurden. Das Alte Testament wurde von den Urchristen als originäres Wort Gottes angesehen und galt somit als Offenbarungszeugnis. Diese Bedeutung wird von den fundamentalistischen christlichen Strömungen heute noch als gültig angesehen. Für viele Menschen sind diese Lehren wichtig und eine Richtlinie auch beim religiös Trauern. Bei der christlichen Beerdigung wird ein Gebet für Verstorbene als Selbstverständlichkeit erachtet.
Entstehung Altes Testament
Die verschiedenen Schriften des Alten Testaments wurden als Grundlage der Religion über Jahrhunderte gesammelt. Dabei wurden viele Teile eine lange Zeit nur mündlich überliefert, ehe sie – ursprünglich auf Aramäisch und Hebräisch – schriftlich erfasst wurden. Die ältesten Teile umfassen die Geschichte der Schöpfung der Welt, die Urgeschichte der Menschheit bis hin zur Einwanderung des israelischen Volkes in Kanaan. Die Erzählungen stützten sich dabei unter anderem auf Stammesüberlieferungen und Sagen sowie weitere mündliche Berichte.
Die Sammlung wurde fortgesetzt mit historischen Berichten über die politische Geschichte Israels, in denen die Geschicke des israelischen Volkes unter den verschiedenen Königen geschildert wurden. Außerdem fügte man den Schriften auch die Äußerungen verschiedener Propheten hinzu, die ebenfalls als von Gott inspiriert angesehen wurden. Ergänzt wurde das Alte Testament weiterhin auch mit poetischen Werken wie den Psalmen oder Unterweisungen bezüglich spiritueller Weisheiten.
Aufbau Altes Testament
Das Alte Testament ist mehr oder weniger chronologisch gegliedert und beginnt mit dem so genannten Pentateuch, den fünf Büchern Mose. Diese umfassen die Schöpfungsgeschichte bis hin zum Einzug ins gelobte Land. Es folgen die so genannten Geschichtsbücher, in denen die Abfolge der verschiedenen Könige Israels sowie die historischen und politischen Ereignisse dieser Jahrzehnte und Jahrhunderte geschildert werden. Der dritte Teil enthält verschiedene Schriften von Propheten sowie weitere Lehrbücher und Unterweisungen. Auch poetische und apokalyptische Texte gehören zu diesem Teil.
Literarisch gesehen umfasst das Alte Testament sehr viele unterschiedliche Textformen, da es sich ja über Jahrhunderte dynamisch entwickelt hat. So findet man poetische und lyrische Teile, einfache Erzählungen, Gesetzestexte sowie Prophezeiungen und apokalyptische Visionen. Die modernen Übersetzungen des Alten Testaments variieren dabei im Inhalt ein wenig, da sie sich auf unterschiedliche Originale stützen. Zum Teil wurden die Übersetzungen direkt auf der Basis der aramäischen und hebräischen Originale erstellt, andere wiederum nahmen eine frühe griechische oder lateinische Übersetzung als Ausgangspunkt.
Am gebräuchlichsten war im deutschen Sprachraum lange Zeit die so genannte Luther Bibel, seit einigen Jahrzehnten gibt es jedoch auch die Einheitsbibel, an deren Übersetzung aus den aramäischen und hebräischen sowie griechischen Texten katholische und evangelische Theologen gemeinsam gearbeitet haben. Es existieren jedoch auch freiere Übersetzungen in moderner Sprache, um die Texte leichter und flüssiger lesbar zu machen.